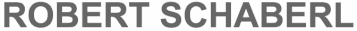Die Verunklärung von Wahrnehmung
Zu den Zentralformen von Robert Schaberl
Kreisrunde Formen, die an Tondi, Mandalas, aber auch vexierbildhaft an Tunnel und gleichzeitig an Lichtkegel erinnern, deren changierende Farben je nach Standort des Betrachters sich verändern, deren Oberflächenstruktur entweder spiralförmige Sogwirkung ausstrahlt oder konvexartig schillernd ihre Materialität verunklärt, ziehen den Betrachter an.
„Zentralformen“ nennt Robert Schaberl seine Arbeiten, die zunächst die sinnliche Wahrnehmung ansprechen sollen, um dann von einer analytischen Reflexion dieser Wahrnehmung untersucht zu werden. So kippen die haptischen, lichtbündelnden Oberflächen und lösen sich bei näherer Betrachtung in Farbmassen, Kratzspuren und Spiegelungen auf.
Das Spiel von Nähe und Entfernung, das Verschwinden des Gegenstandes und des illusionistischen Aspekts zugunsten der Visualisierung von Qualitäten wie Form, Licht und Reflexion ohne inhaltlichen Vorwand hat eine lange, sowohl kunst- wie auch kulturhistorische Tradition. Befasst man sich als Betrachter mit dem Versuch, den „richtigen“ Standort, der die schönste Illusion garantiert, einzunehmen, denkt man sofort an „Las Meninas“ von Diego Velázquez (1656) und an die gemalten Architekturen Andrea Pozzos (z.B. an die Apotheose des Herkules als Deckenbild im großen Saal des Palais Liechtenstein in Wien, 1709). Jede Standortveränderung beeinträchtigt bei diesen Arbeiten den Eindruck, eingebunden zu sein in ein Zeremoniell, wobei die Distanzfrage ganz wesentlich ist. Denn nur aus der richtigen Distanz zum Bild erfährt der Betrachter die Qualität des immateriellen Farblichts und die Visionskraft der Farben.
Die Abkehr vom Verständnis des Bildes als „Abbild“ oder „Sinnbild“ und seine sich daraus entwickelnde Autonomie erreicht im Kubismus auf Basis der aus dem Impressionismus stammenden Frage, wie Dinge wahrgenommen werden und der analytischen Hinterfragung des Darstellungsgegenstandes und dessen Wahr-nehmung eine Stufe, in der Elemente aus dem Gegenstand herausgelöst werden, die ihn als dreidimensionalen Körper erkennen lassen, wie Wolfgang Drechsler und Peter Weibel in ihrem Aufsatz „Malerei zwischen Präsenz und Absenz“ 1 klar darlegen.
Im Zentrum der künstlerischen Intention der Futuristen, Orphisten, Rayonisten, aber auch von Mondrian, steht die Gegenstandsanalyse, aber auch das Interesse an der Bewegung des Gegenstandes, dessen Auflösung und Durchdringung durch Licht. Zentralfigurale Kompositionen, ausgehend von der Vernachlässigung der Bild-ecken, entstehen ebenso wie die „Fensterbilder“ von Robert Delaunay, bei denen sich Repräsentation in Farbe und Licht auflösen und die Eigenwelt der Malerei – Farben, Formen und Licht – zum Vorschein kommt und die Guillaume Apollinaire als reine Malerei, „peinture pure“, bezeichnet.2
Die Gleichsetzung von Farbe und Licht, ermöglicht durch die Erfahrung der Wirkung des Simultankontrastes der Farben durch M.E. Chevreul im Jahr 1839, führt zur Feststellung Delaunays, dass „die Farbe die Funktion der Form übernimmt und die Form nicht deskriptiv ist, sie trägt sich selbst und in sich ihre Gesetze.“3
Aus diesen Überlegungen entstehen Delaunay‘s zirkuläre Formen, die „disques simultanés“, auf denen die Farbe kreisend aufgetragen verwendet ist und die Form sich aus dem zirkulären Rhythmus der Farbe entwickelt. Seine klaren Formen stellten die Voraussetzung für spätere Malerei, etwa die von Stella, Noland oder Kelly. Die vom Zwang der Gegenstandsdarstellung befreite Farbe ermöglicht aber auch ihre Identifikation mit dem Licht, dem sie entstammt.
In weiterer Folge entledigt sich Barnett Newman durch sein neues Prinzip der Spiritualität und Transzendenz der vertrauten Formen der Abstraktion und errichtet mit dem ihm, Marc Rothko und Ad Reinhardt gemeinsamen Ziel vom „Bild des Bildlosen, Gestalten des Gestaltlosen“ 4 unendliche meditative Farbräume, bei denen es zu keiner Explosion, wie bei Jackson Pollock, sondern zu einer Implosion kommt, aus der die Farbe und die Fläche befreit hervorgehen und eine transzen-dentale Erfahrung ermöglichen.
Die Entmaterialisierung des Bildes und das Abheben von der Gegenstandsreferenz hin zur Transzendenz haben hier ihren Ursprung. Diese, auf konstruktivistischer Tradition basierende Entmaterialisierung findet in der Immaterialität von Dan Flavins Lichtinstallationen ihre Fortsetzung und führt die nächste Künstlergeneration zur minimalen Malerei oder Lichtprojektion, zu Robert Ryman, Agnes Martin, Robert Irwin, James Turrell und Douglas Wheeler.
Von hier aus können bereits direkte Referenzlinien zur Arbeit Robert Schaberls gezogen werden. Vor allem die Befreiung des Stoffes Licht von der Erzeugung beliebiger illusionistischer Bilder, wie Fotos, Film oder Video, die bei James Turrell zum puren Licht-Bild, von seinen „perceptual cells“ bis zum „Roden Crater“, mit der ihnen eingeschriebenen Isolation und gleichzeitigen Öffnung in ein bislang unentdecktes Universum führt, ist für Robert Schaberl von Bedeutung. Wenn Wolfgang Schöne zu Signorellis „Großer Pan“ (um 1490) schreibt: „Die dargestellte Bildwelt und das Licht als Lichtquelle sind geschieden. Das Licht selbst erreicht uns Betrachter nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar als Reflexlicht. Stellt man sich in einem Gedankenexperiment vor, die Lichtquelle verlösche, so würde es im Bild zwar dunkel, die Bildwelt wäre unsichtbar, sie bliebe aber bestehen“ 5, so ist klar, dass die Geschichte der Auseinandersetzung mit Licht bis in die frühest denkbaren Vorstellungswelten zurückreicht. Jede Religion basiert auf der Unter-scheidung von Licht und Schatten und in vergangenen Kulturen, wie in Ägypten (z.B. der Tempel des Amun Re in Karnak), bei den Kelten (z.B. in New Grange), aber auch von Irland über England, die Bretagne bis nach Spanien, lassen sich kultische Bauten finden, die sich mit der Idee des Räume erhellenden Lichtes auseinandersetzen.
Tatsächlich aber wissen wir bis heute nicht, was Licht ist. So weist Arthur Zajouc darauf hin, dass sich Francis Bacon Anfang des 17. Jahrhunderts fragt, warum Form und Ursprung des Lichts so wenig erforscht worden sind und vermerkt gleichzeitig: „So hat die Quantentheorie auf der verlässlichen Grundlage von Experimenten nachgewiesen, dass die vereinfachenden, mechanischen Konzepte der Lichttheorien früherer wissenschaftlicher Denkrichtungen nicht haltbar sind. Statt dessen hat sie eine neue Theorie des Lichts entworfen, um deren Verständnis alle großen Physiker der Neuzeit von Albert Einstein bis Richard Feynman, gerungen haben – vergeblich, wie sie schließlich selbst eingestanden.“6
Die abendländische Geschichte des Lichts beginnt mit Prometheus, der Zeus das Licht für die Menschen stiehlt und in den Liedern der „Ilias“ und der „Odyssee“ des blinden Dichters Homer. Goethe sollte erstmals 1810 auf das merkwürdige Fehlen der Farbe Blau im griechischen Sprachgebrauch hinweisen. Diese fehlt deshalb, weil kyanos „dunkel” bedeutet. So trägt Thetis bei ihrem Zeusbesuch, geholt übrigens von dessen Götterbotin Iris, ein kyanos, einen Umhang, von dem es heißt: „Kein schwarzeres Gewand gab es als dieses.”7 Ein ähnliches Rätsel gab chloros auf, das später mit Grün gleichgesetzt wurde. In der „Ilias” wird Honig als chloros beschrieben, in der Odyssee ist es die Nachtigall, bei Pindar der Tau, bei Euripides Tränen und Blut, woraus Zajouc schließt, dass es „feucht”, „frisch”, „lebendig” bedeutet habe und den Griechen die äußere Farbwahrnehmung zu unwichtig gewesen sei. „Sie sahen die feuchte Frische der Tränen, und deshalb sahen sie Grün.”8
Es geht also um eine Wirklichkeitswahrnehmung, die kulturell unterschiedlich ist und auch von der Vorstellung von Farben und Licht abhängt, was wiederum mit dem Verständnis des Auges eng in Zusammenhang steht. Wesentlich ist, dass in der Bhagavadgita, und auch bei Homer, Empedokles und Platon zum Sehvermögen eine entscheidende menschliche Aktivität, eine Bewe- gung vom Auge in die Welt hinein notwendig ist, während die Naturphilosophen im 16. Jh., vor allem Kepler und Galilei, mehr an der Physik des Auges interessiert sind, das Sehvermögen zu einer Frage der Mechanik wird, die emotionale Bedeutung verloren geht und die Teilung in Optik und Psychologie erfolgt. Diese begründet sich auf dem Werk „Optik”, der geometrischen Darstellung des Sehens, von Euklid (300 v. Chr), dessen Überlegungen auch die Voraussetzung für die Entwicklung der Zentralperspektive schufen. Alhazan untersucht die camera obscura und stellt fest, dass nichts selbsttätig aus dem Auge ausstrahlt und Leonardo da Vinci, dass das Auge selbst eine camera obscura sei. Bis schließlich René Descartes der Welt der Ausdehnung, der Substanz, der res extensa ein geistiges Prinzip, den Verstand oder die Seele, die res cogitans beistellt.
Seit der Mitte des 19. Jhs. untersuchen Neurophysiologen und Psychologen die Hirnstruktur und definieren das Gehirn zunehmend als Maschine. Heute sind es neben Wissenschaftlern Architekten, Designer und natürlich Künstler, die nach dem Wesen des Lichts auf unterschiedliche Weise forschen.
Ausgehend von einer gestisch-expressiven und spontan-malerischen Arbeitsweise verdichtet Schaberl seine Farbpalette und reduziert sie vorerst auf unterschiedliche Schwarztöne. Bereits hier bemerkt er, dass eine Mischung aus Blau und Schwarz einen dunkleren Effekt ergibt als reines Schwarz, was an das griechische kyanos erinnert.
Formaler Anreiz sind ihm ursprünglich Wasseraufsichten, Landstrukturen, Lava-ströme und schließlich magnetische Zentrierungspunkte und zyklische Wieder-holungsmuster. Daraufhin untersucht er runde Formen, die er in der Natur als Wachstumsform und vom Menschen aus Praktikabilitätsgründen geschaffen findet und parallel zu seiner malerischen Arbeit auch fotografisch bearbeitet.
Dabei setzt er sich mit den ursprünglichen Möglichkeiten des Entstehens von Negativ / Positiv und mit den Abläufen von Zeit und Bewegung auseinander. Dafür sucht er nach Objekten, die von sich aus feinste Partikel produzieren und die Bildvorlage bilden. Vorzugsweise sammelt er Pilze und legt jeweils zwei bis drei, einer davon ist immer giftig und erzeugt die „diabolic beauty”, wie Schaberl sagt, nacheinander auf eine Glasplatte. Der Zersetzungsprozess, der nach einigen Stunden eintritt, das Abfallen der Sporen, hinterlässt organische, durch Lufteinwirkungveränderte Strukturen, die sich selbstreferentiell spiegeln. Diese „Bilder” werden von Schaberl gescannt, gereinigt und als Lambdaprints realisiert.
Durch die naturgegebene eventuelle Entwicklung von Dampfflüssigkeit entsteht der Eindruck von Sepiamalerei, wobei Schaberl das Prozesshafte ebenso wichtig ist wie das Spiel mit dem Zufall, den er durch den von ihm gesetzten Abbruch des Prozesses steuert. Hat sich ein Wurm im Laufe der Stunden durch den Pilz gefressen, so wird dessen Spur und damit auch der Zeitablauf sichtbar.
Mittels eines induktiven Verfahrens scheinen in den Pilzfotos Beweise geführt zu werden, um sie gleichzeitig durch ästhetische Werte aus einer rein intellektuell-rationalen Sichtweise zu nehmen. Ebenso wichtig ist Schaberl auch die Ambivalenz zwischen dem Berührungsverbot von künstlerischen Fotografien und dem in seinen gemalten Bildern entstehenden haptischen Reizen. Die unterschiedliche Dichte der übereinander gelagerten Schichten, die Verunklärung von Gesehenem korrelieren mit der formalen Assoziation zwischen Auge und Zelle.
Das Auge des Ra, die Urform des göttlichen Seins im ägyptischen Verständnis und damit der retinale Reiz von Bildern, der bei Marcel Duchamp zur Verweigerung von Kunstproduktion führt, wird von Schaberl ebenso angesprochen wie der nüchterne Umgang mit Sinnlichkeit sowie die Verunklärung von Vertrautem. Diese Verunklärung führt zu einer Interaktion zwischen Betrachter und Bild und resultiert aus einem Dialog zwischen Künstler und Material. Dabei interessiert Schaberl die Bündelung von Licht und die Frage, wie sich aus der Oberfläche eine Struktur entwickeln lässt, die aus der Fläche herauswächst. Dafür wählt er den zentralen Punkt einer angenommenen Mitte, die nicht identisch mit der geometrischen ist, von dem weg er über eine aufgetragene Spachtelmasse penibel kleine Pinselstriche mit transparenter Ölfarbe führt.
Waren es anfangs Schallplatten, deren Berührung ebenfalls ein Tabu darstellt, deren Oberfläche, Form, Spiegelung, Fräsung und Lichtbündelung für Schaberl von Interesse waren und von denen ausgehend er sich mit der Intensität der Farbe Schwarz auseinandersetzte, so werden in der Folge Fragen nach Farbe, Licht, Raum und Zeit in eine illusionäre Darstellungswelt überführt.
Mit Hilfe unterschiedlicher Lasuren und Interferenzpigmenten schichtet er Farbe monoton- meditativ übereinander und schafft dadurch dreidimensional erscheinende Gemälde, die aus einer Perspektive nie vollständig erfassbar sind. Durch die Reflexion des Lichtes und die obsessiv- konsequent gestaltete Bildoberfläche ändert sich die Farb- und Raumwirkung im Bild und täuscht die Sinneserfahrung des Betrachters, weil Schaberls Arbeiten mit Prozessen zu tun haben, die beim Sehvorgang ablaufen.
Es ist nicht mehr das „Beleuchtungslicht” wie bei Caravaggio oder Georges de la Tour oder das „Reflexleuchtlicht” wie bei Rembrandt, es ist auch nicht mehr der Licht-Raum-Modulator von László Moholy-Nagy oder die angestrebte Reflexions-potenz von Licht bei den ZERO- Protagonisten Uecker, Piene oder Mack und auch nicht mehr die Lichtproblematik von Barnett Newman, die Schaberl zu religiös und radikal anmutet (seine Flächen dürfen nicht glänzen), es handelt sich bei Schaberl um eine, nicht mehr auf ein Dargestelltes gerichtete, lichtvolle Tiefe, die gleichzeitig in eine nahezu distanzlose Nähe transloziert wird.
Das transluzierende Farblicht, das ihn allerdings bei Turrell beeindruckt, belässt Schaberl auf einer dreidimensionalen Oberfläche, um es wieder direkt auf das Auge zurückzulenken. So entsteht eine Oberfläche, die durch ihre plastische Materialität nicht nur eine fragil beschichteteStruktur besitzt, sondern auch verschiedene Farbwirkungen und optische Phänomene auf einem Bild vereint. Einmal erscheint das Zentrum hell und die äußeren Schichten dunkel, dann ändert sich der Eindruck und das Zentrum wird dunkel. Das heißt, unsere Wahrnehmungen von Raumtiefe, Licht und Farbe werden ständig verunklärt. Eine seiner letzten, ca. zwei Meter durchmessenden Arbeiten ist überzogen von durchscheinenden, perlmuttfarbenen Farbschichten, die explizit auf die Spektralfarben und den Regenbogen verweisen, der für Hesiod eine Manifestation der Göttin Iris darstellt und damit wieder auf die Frage, was Licht sei, zurückweist.
Wir finden also bei Schaberls Arbeit eine neue Art der Zusammenführung von emotionaler und hoch ästhetischer Darstellung und streng strukturierter Arbeitsweise, die den Betrachter erneut die Quelle des Lichts bezweifeln lässt, damit verunsichert und Interaktivität mit Selbstreferentialität paart.
Elisabeth Fiedler
1 in: Bildlicht. Malerei zwischen Material und Immaterialität, hg. von den Wiener Festwochen, Wien 1991. 2 G. Apollinaire: „Reine Malerei bedeutet vielleicht reines Licht“, zit. nach: R. Delaunay, Zur Malerei der reinen Farbe. Schriften
von 1912 bis 1940, hg. von Hajo Düchting, München 1983, S. 135. 3 R. Delaunay: Du Cubism à L‘Art abstrait, hg. von P. Fraucastel, Paris 1957, S. 97. 4 Ad Reinhardt, Kat. Kunsthaus Zürich 1973, S. 30. 5 Wolfgang Schöne, Über das Licht in der Malerei, Berlin 1954, 1977, S. 11. 6 Arthur Zajouc, Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein, Hamburg 1994, S. 18. 7 Homer, Ilias, übers. von Wolfgang Schadewaldt, 22. Gesang, Vers 401 – 402, Insel, Frankfurt am Main, 1975, S. 376. 8 a.a.O., S. 28.
Auszug aus dem Ausstellungskatolog anlässlich der Ausstellung in der Neuen Galerie im Hof in Graz 3. Juli bis 22. August 2004: Robert Schaberl ... von Licht und Farbe © 2004 Neue Galerie Graz